 NZZ Folio: Wanne-Eickel (1997)
NZZ Folio: Wanne-Eickel (1997)
NZZ-Folio ist eine illustrierte Beilage der Neuen Zürcher Zeitung. Im September 1997 widmete sie Wanne-Eickel in eigenes Heft. Was nicht ganz stimmt, denn viele Beiträge handeln vom Ruhrgebiet
allgemein und haben wenn, dann höchstens mittelbar etwas mit Wanne-Eickel zu tun. Wenn’s um Schalke 04 geht, zum Beispiel, oder wenn die Stadtortbestimmung des deutschen Steinkohlebergbaus Thema ist.
Die NZZ portraitiert aber auch einige Wanne-Eickelerinnen und Wanne-Eickeler, Zugezogene und Urgesteine. Und einige Beiträge befassen sich tatsächlich mit unserer Heimatstadt. Bitteschön:
Stille Tage in Wanne-Eickel
Dackel werden bespritzt, Highland-Terriers Rikscha gefahren, Tauben aufgelassen, Seelen erhoben: am Sonntag, dem Tag des Herrn und des Herrchens.
Von Ursula von Arx
„So wurden Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer vollendet. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem Schöpfungswerk.“ So sprach der Herr am siebten Tag, und so spricht in Art. 140 auch das deutsche Grundgesetz: „Der Sonntag soll im Dienste der seelischen Erhebung stehen.“
Unter der Sonntagssonne liegt Wanne-Eickel brütend und leer, als wäre der basaltgepflasterte Stadtteil von einer ungeheuren Faust in die Magengrube getroffen worden. Nichts, kein Liebeskummer, kein Gefängnis, kann so verzweifelt sein wie eine sonnige Fußgängerzone mit toten Geschäften und toten Schaufenstern. Lebendig sind hier nur die paar wenigen Mütter mit Kinderwagen.
Geht man in ein Restaurant, tragen die Leute ihre besten, die Sonntagskleider: Gürtel kämpfen mit Bäuchen, die unter gebügelten Hemden stecken, aufgestellte Kragen drücken sich in männliche Hälse, Modeschmuck umringt die weiblichen - und Finger und Handgelenke. Sonntagsstaat lässt die Menschen ärmer aussehen als in Overalls.
Geht man den Wohnhäusern, den Schrebergärten entlang, kann man an diesem ersten Sonnensonntag des Jahres 1997, dessen Sommer bis anhin wie eine kleine Vorschau auf die endgültige Sintflut war, jede Menge entblößte, sehr weiße Männerbäuche sehen und ihre Brüste, die ja nicht selten zusammen entstehen. Das sei so, weil in der Hefe des Bieres weibliche Hormone enthalten seien, Östrogen vor allem. Die Erklärung wirkt glaubhaft, denn ein Bierchen steht immer griffbereit in der Nähe. Es raucht und riecht nach Gegrilltem. Mann und Frau entspannen sich im Liegestuhl, ein Nachbar schaut vorbei, bald ein zweiter. Die Frau empfängt den Besuch in Lockenwicklern, das ist ganz in Ordnung. Die Kinder spritzen sich mit dem Gartenschlauch ab und quietschen dabei vor Vergnügen. Dem Dackel gefällt es weniger.
Irgendwo sind Vögel, irgendwo sind Mücken, die Wanne-Eickeler fressen, ab und zu hört man ein Radio und ein Auto auf der Brücke. Die Minuten, die verstreichen an diesem ewigen Sonntag, fallen nach einem leisen Zischen klanglos ins langsam vorbeiziehende Wasser, wie abgebrannte Raketen.
Er lehnt sich an seine Suzuki 500, in der einen Hand eine Cola, in der anderen ein Schinkensandwich. Der Halbmond über seinen Lippen ist unregelmäßig rasiert, doch nein, das ist ja nur ein bisschen Mayonnaise. Aus seiner Jeansjacke, die er direkt auf der Haut trägt, schaut das Päckchen Marlboro wie ein Schweizer Nationalbrusttüchlein. Wanne-Eickel am Sonntag? Tote Hose! sagt der in Shorts gekleidete Thorsten. Der junge Mann ist mit 27 Jahren der einzig Ledige unter seinen ehemals dreißig Mitschülern und Mitschülerinnen. Er ist heute an den Kanal gekommen, weil er doch noch hoffte, einen seiner Kollegen hier zu treffen. Aber die sind jetzt mit Windeln beschäftigt. Unter den paar Velofahrern hat er vergeblich gesucht. Früher war hier am Kanal ein Riesengaudi, sagt Thorsten, das Ufer war überfüllt. Jetzt gehen die Leute alle auswärts. Nach Haltern etwa, da gibt es einen Stausee, man kann baden, und die Infrastruktur ist besser, es gibt etwas zu essen. Manche gehen nach Bochum und Essen, da ist etwas los, Rummel, massenweise Ampeln und Stau. Ja, er fahre jetzt noch nach Bochum. Mal schauen, was da läuft.
 |
Es steht schlecht um die menschliche Seele am Ende des zweiten Jahrtausends. Der Nahverkehr ist lebendiger als der Verkehr mit dem Himmel.
Werdet wie die Tauben. Höher und höher und schneller fliegen sie und lassen uns Menschen zurück, bis wir nur noch Pünktchen von Pünktchen sind und das Grün der Wälder sich nur noch durch eine winzige Nuance vom Rapsgelb unterscheidet, und vielleicht fliegen sie so hoch, dass unklar wird, ob es sich bei diesen weißen Streifen um Wolken oder um ein Gebirge handelt. Hunderte von Kilometern legen Tauben zurück, um irgendwann nach Hause in ihren Schlag zu ihrer Täubin zurückzukehren. Die sie mit offener Kloake empfängt.
„Aber in Wahrheit kommen meine Tauben nur wegen mir zurück.“ Selbstverständlich sagt Vater Reh das mit einem Zwinkern. Aber – Hand aufs Herz – er glaubt doch daran. Er muss. Wie könnte er sonst seit sechzig Jahren jeden Tag von morgens um sieben Uhr an mindestens vier Stunden bei seinen Tauben verbringen, sommers wie winters? Am Nachmittag wird er dann von seinem Sohn abgelöst im Taubendienst. Und am Abend telefonieren sie noch einmal. Der achtjährige Sohn des Sohnes ist den Tauben auch verfallen, wie es der Vater des Vaters schon war.
In einer Woche wird das Ende und der Höhepunkt der Saison 1997 da sein. Die Tiere der 71 Mitglieder der „Reisevereinigung“, so heißt der Brieftaubenzuchtverein Wanne, werden nach Liegnitz, Polen, transportiert und dort aufgelassen, damit sie so schnell wie möglich die rund 625 Kilometer nach Hause zurücklegen. Ihre Besitzer haben auf sie gewettet. Mit dabei sind Fuchs und Hannes, die Lieblinge von Vater Reh. Der Hannes mit den klugen Augen. Der Hannes, der dem Sperber in die Fänge kam. Schon zwei Tage war er überfällig. Zehnmal rannte man hin und her, um zu schauen, ob Hannes noch fehlt, ob Hannes nicht vielleicht doch schon gekommen ist. Und dann, am Dienstag morgen, wer knallt da vor die Scheibe? Hannes ohne Schwanz. Der ganze Rücken war aufgekratzt. Da haben sie ihn wieder hochgepäppelt, den Burschen. Mit Vitaminpräparaten und Bierhefe und Knoblauchsaft zur Blutreinigung und Sonnenblumenkernen und mit den aus Amerika importierten Erdnusssamen.
Geld verdienen kann man nicht mit den Tauben. Auch wenn gerade eben ein Japaner auf der Verbandsausstellung 50.000 DM zahlte fĂĽr so einen Federball. Tauben kosten nur. Die Eier kosten, das
Futter kostet, die Registriermaschine kostet, der Transport an die Auflassorte kostet, die Vereinsbeiträge kosten.
Frau Reh, sind Sie nicht eifersĂĽchtig auf die Tauben, die soviel Geld und Zeit Ihres Mannes beanspruchen?
„Aber nein. Wo denken Sie denn hin. So ist mein Mann beschäftigt, das hat auch seine Vorteile.“
Im Ruhrgebiet und in Belgien, da sind die Tauben groß, da werden die nächsten Jahrhundertvögel gezüchtet. Wo es Kohle gibt und Kumpel, gibt es Tauben. Das eine scheint das andere hervorzubringen und zu bedingen. Warum? Wer unten, tief unten in der rabenschwarzen Erde wühlt und Negativpaläste baut, braucht seine Luftschlösser. Die Tauben, die durch die Lüfte fliegen. Aber nicht frei, sondern zwanghaft immer nach Hause, und zwar so schnell wie möglich. So treue Tiere!
Frau Reh, warum ist Taubenzucht Männersache?
„Vielleicht, weil lange nur Männer ins Wirtshaus gingen. Und die Tauben waren ein Vorwand, immer
wieder zu gehen. Hier in unserem Schrebergarten treffen sie sich während der Saison immer wieder. Sie trinken ein Bier, grillen. Sie haben nur ein Thema: Tauben. Am Samstag, wenn Probeflüge sind, sind sie
schon am Morgen früh hier. Sie erwarten die Tauben, denen sie ja Ringe wie Eheringe anlegen.“
Es ist Abend geworden, die Erde hat sich abgekühlt. Der Cranger Kirmesplatz ist riesig und leer. Nicht ganz. Auf einem Baumstrunk sitzen Vater Karl, Sohn Heinz und Nachbar Felix. Daneben geparkt sind ihre Fahrräder mit Körbchen, Rikschas für ihre Hunde Cessy, Trixi und Moritz, drei weiße, mit Haarmaschen geschmückte West-Highland-Terrier. „So gut wie meine Hunde möchte ich es auch einmal haben“ (Heinz). Im Ghettoblaster ist Helge Schneider dabei. Irgendwann fängt Karl an zu singen, mit einer schönen und weit tragenden Stimme singt er in die Dunkelheit hinein: Tabak und Rum braucht ein Cowboy / Tabak und Rum, ja, das braucht er sehr / Doch einen Kuss von seiner Jenny / Ja, den braucht er noch viel mehr (3×).
Und Heinz und Felix sind sich einig, dass an Karl mindestens ein Heino verlorengegangen ist.
Sonntag Nacht, kurz nach dem stillen Kuss von Himmel und Erde, erhebt sich der Mond über Wanne-Eickel, und es erheben sich – wie vom deutschen Grundgesetz gefordert – die Seelen und fliegen alle taubengleich nach Haus, zusammen mit ihren fleischlichen Kerkern und deren Besitzern. Zu dritt müssen sie am nächsten Morgen wieder aufstehen, zur Arbeit.
(Herzlichen Dank an Barbara Wannert, die das NZZ-Folio freundlicherweise zur VerfĂĽgung gestellt hat!)
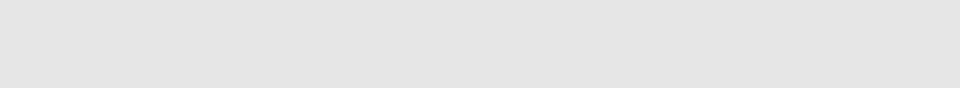
powered by:

|
|
||
|
|

