NZZ Folio: Wanne-Eickel (1997)
 |
Im roten Herrgottswinkel
Wanne-Eickel, im Herzen des Ruhrgebiets, hat kaum mehr Kohle, aber noch den alten Kumpelgeist. Ein Streifzug durch die postindustrielle Provinz.
Von Peter Haffner
Alles, was man so zum Leben braucht - wie zum Beispiel eine ordentliche Auswahl an Bestattungsinstituten - findet man in Wanne-Eickel an der Hauptstrasse, die deshalb auch âHauptstraĂeâ heiĂt. Mag es einem schwer fallen, sich fĂŒr einen der ausgestellten SĂ€rge oder eine nette Urne zu entscheiden: Seiner Habseligkeiten kann man sich leicht entledigen, stehen doch Entsorgungscontainer fĂŒr Kleider, Schuhe und die vielleicht letzte Flasche â âEinwurfzeiten nur werktags von 7.00-19.00 Uhrâ - ebenda an jeder Ecke.
Ja, die Deutschen haben einen Sinn fĂŒr Ordnung, und wer bei Rot ĂŒber die Strasse geht, wenn weit und breit kein Auto naht, outet sich als AuslĂ€nder. Das ist in Wanne-Eickel nicht anders als anderswo in Deutschland, und auch hier ist die FuĂgĂ€ngerzone eine Fortsetzung der guten Stube mit anderen Mitteln: âAngelas Geschenkpassageâ, âNinas Bildermarktâ oder âChristines BlumenstĂŒbchenâ sind adrett zwischen BrĂ€unungscenter, Gardinenstudios und Kneipen gestreut, deren Aushang ein Schnapsangebot auflistet, das auswendig zu lernen mehr MĂŒhe machte als Schillers âGlockeâ.
Was anders ist in Wanne-Eickel, hat mit seiner Lage zu tun. Es liegt mitten im Ruhrgebiet, und noch immer weckt dieser Name, als sei er die Bezeichnung fĂŒr einen Krankheitsherd, Bilder von schwarzen, schwĂ€renden Wolken ĂŒber einer von Kohlestaub verschleierten Silhouette von Schloten, Förderböcken und Gasometern. Kokereien, StahlhĂŒtten und Zechen, bevölkert von Kumpeln, deren AugenweiĂ leuchtet wie das der Eingeborenen im Kongo - das war einmal. Deutschlands schwarzer Kontinent ist grĂŒn. Es fĂ€llt schwer, in Wanne-Eickel herumzuspazieren, ohne sich in einen Park zu verirren, in ein Feuchtbiotop zu stolpern oder in eine Magerwiese zu treten. Da sitzt man dann, in der Nase den Duft von frischgemĂ€htem Gras, hört die Vögel zwitschern und die Kirchenglocken bimmeln und wĂŒrde, wĂ€re man mit verbundenen Augen hergefĂŒhrt worden, jede Wette eingehen, man sei irgendwo da, wo Landmann und Vieh sich gute Nacht sagen.
Es ist gar nicht so lange her, da war es auch so. In Crange, am Rhein-Herne-Kanal, wo man eben die tĂŒrkischen Viertel von Wanne hinter sich gelassen hat, trifft man auf ein Nest von FachwerkhĂ€uschen aus dem 18. Jahrhundert, die mit ihren schiefen WĂ€nden und den wettergebrĂ€unten Riegeln, mit ihren Gott, GlĂŒck und gute Gaben beschwörenden Inschriften einen Eindruck von der dörflichen Idylle geben, die das Ruhrgebiet prĂ€gte, bevor die Kohle kam. Es ist, obzwar bewohnt, ein Freilichtmuseum und auf seine Weise ebenso irreal wie die Buden und Bahnen der Schausteller, die hier zur Cranger Kirmes alljĂ€hrlich ihre Zelte aufschlagen.
Aber das ist schon alles, was der Bergbau ĂŒbriggelassen hat an vorindustrieller Vergangenheit. Das Ruhrgebiet, Europas gröĂter Industrieraum, ist eine der bevölkertsten Regionen. Herne, eine Stadt mit knapp 180.000 Einwohnern, rĂŒhmt sich der höchsten Siedlungsdichte im Pott, und Wanne-Eickel, das zu Herne gehört - was nicht alle so sehen mögen -, nimmt diesbezĂŒglich gar den Spitzenplatz ein.
Keine Stadt ist hier entstanden, wie StĂ€dte zu entstehen pflegen, von einem Zentrum aus, mehr oder minder nach Plan und, allmĂ€hlich gröĂer werdend, ausgreifend in die Nachbarschaft und sich Dorf um Dorf einverleibend. Das ganze Ruhrgebiet hat kein Zentrum, ist eine Agglomeration von Zechensiedlungen, die um Schachtanlagen und FördertĂŒrme gruppiert sind und zusammengehalten werden von einem Netz von Schnellstrassen und Autobahnen, in dessen Maschen sie hĂ€ngen wie Vogelnester, die jederzeit herunterfallen können. Niemand ist hier im Mittelpunkt, und darum ist es jeder. Das eigentĂŒmliche HeimatgefĂŒhl, das etwa die Kumpel einer Zeche wie Unser Fritz zusammenschweiĂte, findet seinen Ausdruck in der zugehörigen Kolonie, deren zweistöckige, aneinandergereihte BacksteinhĂ€user einen Hof von KleingĂ€rten und Lauben umschlieĂen, wo man GrĂŒnkohl und Karnickel gezogen und seine kleine Welt genossen hatte, bevor die SatellitenschĂŒssel die groĂe in die Stube brachte. Die Kohlelore, bepflanzt mit Geranien, steht noch als Requisit fĂŒr dieses Welttheater, das seine letzte Vorstellung lĂ€ngst gegeben hat. So unmenschlich der Bergbau war, hier oben hat alles sein menschliches MaĂ. Da sind keine HĂ€user in den Himmel gewachsen, ist alles ĂŒberschaubar geblieben, als hĂ€tte man einen Ausgleich schaffen mĂŒssen fĂŒr die schreckenerregenden Tiefen, in denen man sein Arbeitsleben verbrachte. âSorgenfreiâ, âUnverzagtâ oder âUnter BrĂŒdernâ taufte man etwa die KleingĂ€rten, in denen man unter sich blieb, auĂer Reichweite der Schlotbarone, die ihre Villen anderswo hatten. Jetzt, wo alle Zechen aufgelassen, alle FördertĂŒrme abgerissen und alle Halden abgetragen sind, zeugen nur noch die teuer zu sanierenden Industriebrachen von einst. Willy Brandts Vision vom âblauen Himmel ĂŒber der Ruhrâ von 1972 ist Wirklichkeit geworden, und Wanne-Eickel zeigt sich als ein Beispiel jener postindustriellen Provinz, die von der Provinz die Beschaulichkeit, von der Industrie aber den Pioniergeist und ein gesundes Selbstbewusstsein geerbt hat.
Dass immer noch âder Bergbau umgehtâ, wie die Einheimischen sagen, irritiert den Fremden mehr als sie selber. Ihm kann an einer StraĂenkreuzung zumute werden, als hĂ€tte er LSD geschluckt - da fĂ€llt, in sonst topfebener Gegend, die Rathausstrasse unversehens in die Tiefe, nimmt die Quartierstrasse, die sie quert, gleich mit und verbiegt das Pflaster, dass es nur so eine Art hat. Der Horror vacui, der da unten in den alten Flözen sein Unwesen treibt, gestaltet die OberflĂ€che mit. Nichts in dieser Landschaft, das nicht aufgerissen und untertunnelt, plattgewalzt und unterstĂŒtzt wĂ€re. In der Wohnkolonie Unser Fritz gibt es Mieter, die haben die Schiffe auf dem Kanal, die nun ĂŒber ihren Köpfen kreuzen, noch unten durchfahren sehen.
Wirft man einen Blick auf die Statistik, könnte einem bange werden um den Frieden in Wanne-Eickel. Mit 18 Prozent Arbeitslosen erreicht es nahezu den Rekord der neuen BundeslĂ€nder. Doch da ist nichts zu spĂŒren von dieser stillen, depressiven Wut, die in der Ex-DDR mit HĂ€nden zu greifen ist, nichts von Hass auf die AuslĂ€nder, die immer an allem schuld sind, wenn es abwĂ€rts geht. Noch dauert die SolidaritĂ€t, die unter Tage lebensnotwendig war, ĂŒber Tag fort. Zumal der echte Wanne-Eickeler ohnehin ein Zugewanderter ist, wie die zahlreichen polnischen Namen an den TĂŒrschildern verraten. Zu den Jablonskis, Szapsziks und Kaczmareks der Jahrhundertwende sind in den siebziger Jahren die AygĂŒns, Celiks und YĂŒksels hinzugekommen.
Durchstreift man Wanne-Eickel von SĂŒd nach Nord, in derselben Richtung, die der Bergbau nahm, geht man eine soziale Stufenleiter hinunter, die vom Mittelstand bis zur Arbeiterschaft reicht. Die VorgĂ€rten sagen alles. Wo ImmergrĂŒn im Zierrasen steht, Gartenzwerge den Grill hĂŒten und an den TĂŒren Schilder mit der Aufschrift âVorsicht! Wachsamer Nachbarâ kleben, hat man es weniger nötig, von eigener Ernte zu leben, als den Besitzstand zu wahren. Wo WĂ€lder von Bohnenstangen rauschen, sind â darauf kann man so sicher zĂ€hlen wie auf den BMW oder Mercedes, der vor dem Haus steht â TĂŒrken nicht weit, die sich das Prestigeauto so vom Munde absparen. Sie sind es, die den Bergmannsbrauch des Nutzgartens heute weiter pflegen.
Die TĂŒrkei beginnt, wo die FuĂgĂ€ngerzone von Wanne endet. Die Schilder weisen hier nicht mehr nach Gelsenkirchen, Bochum oder Castrop-Rauxel, sondern nach Ankara, Istanbul und Izmir; Destinationen von ReisebĂŒros, die auch sonntags offen haben und ihre Landsleute in die Heimat bringen. Wo mancher dann, wie man sagen hört, Heimweh nach Deutschland bekommt. Was einmal der deutsche âTante-Emma-Ladenâ war, ist nun so gut ein tĂŒrkisches GeschĂ€ft wie der Shop mit orientalischem Krimskrams in Gold und Glanz und Glas. In den Teestuben, hinter heruntergelassenen Jalousien, lĂ€uft der Fernseher mit tĂŒrkischem Programm, sitzen MĂ€nner, schwatzen und vertreiben sich die Zeit. Sie heiĂen einen so auffĂ€llig willkommen, dass man annehmen muss, kein Fremder verirre sich jemals dahin.
Auch der TĂŒrkisch-Deutsche Kulturverein e.V., der mit dem Schild âKomm, was du auch seist, komm!â ĂŒber der TĂŒr zum Besuch lĂ€dt, dĂŒrfte kaum eine bilaterale Angelegenheit sein. Was Engin Madenci, seinen ersten Vorsitzenden, nicht hindert, einem stolz alles zu zeigen: die alkoholfreie Bar mit der islamischen Bibliothek, bunten, goldbedruckten KommentarbĂ€nden zum Koran, den zerschlissenen Billardtisch und den Kickerkasten im Keller, die Moschee â eine von elf in Herne â im ersten Stock und das neue, noch Leim ausdĂŒnstende BĂŒro fĂŒr den GĂ€steempfang. Eine religiöse Vereinigung, aber keine fundamentalistische, fĂŒr die der Bergmann Madenci alle seine Freizeit opfert, jeden Nachmittag vier Stunden, bevor er um zehn zur Schicht einfĂ€hrt, die bis sechs Uhr morgens dauert. Nicht rauchen, nicht trinken, die Kinder von Drogen abhalten und im Islam unterrichten: Nach dem Tod, sagt Engin Madenci, gibt es nur die Hölle und das Paradies und â âwo bekommt man sonst eine Fanta fĂŒr 60 Pfennig?â
Es gibt 17,7 Prozent AuslĂ€nder in Wanne, aber diese Zahl besagt nicht eben viel. Engin Madenci zum Beispiel, der vor drei Jahren seinen deutschen Pass bekommen hat, fĂ€llt nicht darunter, obschon er sich der tĂŒrkischen Kultur und dem Islam verpflichtet weiĂ. Er ist, da die BRD keine DoppelbĂŒrgerschaft duldet, offiziell kein TĂŒrke mehr.
Seit 1994 sind die Gemeinden Nordrhein-Westfalens, die mehr als 5.000 auslĂ€ndische Einwohner zĂ€hlen, verpflichtet, âzur besseren Integration und Beteiligung am Leben in der Kommune AuslĂ€nderbeirĂ€te zu bildenâ. Wahlberechtigt sind alle AuslĂ€nder, die mindestens 18 Jahre alt sind, ein Jahr rechtmĂ€Ăig in Deutschland leben und drei Monate ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben. WĂ€hlbar, neben den Wahlberechtigten, sind alle BĂŒrger, so dass auch EingebĂŒrgerte sich engagieren können. Das 25köpfige Gremium in Herne, zu achtzig Prozent tĂŒrkisch, hat nur beratende Funktion und ist auf das Wohlwollen von Verwaltung und politischen EntscheidungstrĂ€gern angewiesen. Davon dĂŒrfte es durchaus ein bisschen mehr geben, meint Yunus Ulusoy, der Vorsitzende. Mehr Gehör wĂŒnschte man sich namentlich zu Schul- und Erziehungsfragen und zur Stadtentwicklungspolitik. Islamunterricht in den Schulen, eigene Friedhöfe fĂŒr Muslime waren Themen, ohne dass Einigkeit erzielt worden wĂ€re. Sprachprobleme stehen oft zur Debatte. Eine der jĂŒngsten Auseinandersetzungen drehte sich um die Bestimmung, den AuslĂ€nderanteil in KindergĂ€rten pro Gruppe auf 30 Prozent zu beschrĂ€nken. Dass die Stadt eine Notgruppe mit fast nur tĂŒrkischen Kindern eingerichtet hat, wird beklagt, wĂŒrden diese doch demotiviert, sich zu integrieren. Aber es soll auch tĂŒrkische Eltern geben, die ihre Kinder abmelden mit der BegrĂŒndung, in den KindergĂ€rten gebe es zu viele AuslĂ€nder, so dass ihre Sprösslinge nicht Deutsch lernten. Mit TĂŒrkisch kommt man bestens durchs Leben; vom GemĂŒseladen ĂŒbers FachgeschĂ€ft bis zum Arzt und Rechtsanwalt braucht, wer will, kein Wort Deutsch zu sprechen. Vor allem die nicht berufstĂ€tigen Frauen bleiben so abseits.
Und natĂŒrlich sind auch TĂŒrken nicht gleich TĂŒrken. Dass eine bis zur Nasenspitze verhĂŒllte TĂŒrkin perfekt Deutsch spricht, den FĂŒhrerschein besitzt und berufstĂ€tig ist, gehört zu den MerkwĂŒrdigkeiten einer Gesellschaft, die scheinbar widersprĂŒchliche Elemente verschiedener Kulturen mischt und daraus etwas schafft, was es weder hĂŒben noch drĂŒben gegeben hat. Zum kulturellen Frieden tragen im ĂŒbrigen nicht wenig die zahllosen Sportvereine bei; wer boxt, prĂŒgelt sich nicht.
Selbst Werner Brinsa, der als Oberkommissar der Polizeiwache Wanne-Eickel mehr ĂŒber die schwarzen Seiten seiner SchĂ€fchen weiĂ als sonst jemand, muss, befragt nach den NiedertrĂ€chtigkeiten seines Reviers, ein ganzes Weilchen nachdenken. Ja, vor ein paar Tagen, da packten sie drei Polen am Schlafittchen, die eben ein Dutzend Karpfen aus dem Stadtteich gefischt hatten. âMangelndes Unrechtsbewusstseinâ sieht der Polizist als Hauptproblem, etwa auch wenn TĂŒrken verbotenerweise Schafe schlachteten oder ihre Kinder ĂŒber die Schrebergartenhecke hievten, damit sie etwas zur Selbstversorgung beitrĂŒgen. Man mĂŒsse, sagt Werner Brinsa, ihnen dann halt erklĂ€ren, dass das nicht geht. Wenn man den EndfĂŒnfziger so vor sich sieht, mit seinem Kinnbart und dem gemĂŒtlichen Lachen, glaubt man ihm gerne, dass er das auch ganz gut versteht. SchlieĂlich ist er selber in einem Haus mit AuslĂ€ndern aufgewachsen, und daran erinnert er sich als an die schönste Zeit seines Lebens. Kein Fest, das ausgelassen worden wĂ€re, und dann die HahnenkĂ€mpfe mit den jungen Italienern, die oft nicht ganz erfolglos ihren MĂ€dchen nachstellten.
Seit bald drei Jahren fĂ€hrt Werner Brinsa mit der Mobilwache raus, einem mit fĂŒnf Mann besetzten, mit Gute-Laune-Klebern bepflasterten VW-Bus, der tĂ€glich morgens und abends an zwei Standorten parkiert wird und als Kontaktstelle zur Bevölkerung dient. Man plaudert mit Rentnern, Kindern, AuslĂ€ndern, hört sich ihre Sorgen und Nöte an und bekommt auch schon einmal einen Tipp, wo ein Ding gedreht werden soll. Eine Art englisches Bobby-Prinzip; der gute Polizist, nicht der böse Bulle. Im ĂŒbrigen sollen vermehrt Beamte tĂŒrkischer Herkunft eingestellt werden. Man geht die Dinge praktisch an. Als passionierter Motorradfahrer hatte Werner Brinsa schon in den sechziger Jahren die Rockergangs an der Cranger Kirmes im Zaum gehalten, indem er ihren Maschinen Polizeiaufsicht gewĂ€hrte mit dem Hinweis, wenn sie Zoff machten, kriegten sie diese nicht wieder. âWar nicht ganz legal, hat aber funktioniert.â
Was sonst in Herne lĂ€uft, geht nicht ĂŒber das landesĂŒbliche MaĂ hinaus; KleinkriminalitĂ€t, Drogenhandel, gelegentlich ein Mord, meist im Milieu. Dass in den zahlreichen Spielhallen Geld gewaschen wird und jugendliche Arbeitslose mit Tausendmarkscheinen in der Hosentasche kaum nur vom Sozialamt leben, ist zu vermuten.
Als 1993 in Solingen bei einem Brandanschlag Jugendliche fĂŒnf TĂŒrkinnen ermordeten, richtete man in Herne einen ârunden Tischâ ein, um solchem zuvorzukommen. Der familiĂ€ren AtmosphĂ€re, die einem die Stadt, mitsamt allen Zwistigkeiten, vermittelt, ist es zu danken, dass es nicht soweit gekommen ist. Hier kennt jeder jeden, was der Besucher unschwer daran erkennt, dass auch er bald an keinem Tresen mehr stehen kann, ohne als alter Bekannter begrĂŒĂt zu werden.
Manfred Urbanski hat als letzter OberbĂŒrgermeister von Wanne-Eickel und als erster des neuen Herne den schwierigsten Akt dieser Familiengeschichte aus- und durchgestanden: die Verheiratung der beiden StĂ€dte. Keine Liebes-, sondern eine Mussheirat. Sein Amt, das er von 1969 bis 1984 innehatte, war damals noch ein Ehrenamt. Das bedeutete oft genug einen Sechzehnstundentag und jedes Wochenende âGrosseinsatzâ: kein Verein, von den GeflĂŒgelzĂŒchtern bis zur Blasmusik, der das Stadtoberhaupt an seinem Festanlass missen mochte. Sein Brot verdiente der gelernte Maschinenschlosser als GewerkschaftssekretĂ€r. Es war in einer Zeit, in der man, wenn man morgens ein weiĂes Hemd anzog, sich abends nicht mehr damit zeigen konnte. Doch der Niedergang der Kohle war besiegelt, der Zusammenschluss kleinerer StĂ€dte zu gröĂeren eine beschlossene Sache. Fragte sich nur, wer mit wem. Im GesprĂ€ch, das eine Flasche Schnaps und ein paar Flaschen Bier dauert, erlĂ€utert der joviale HĂŒne jede einzelne dieser jahrelang diskutierten Varianten, bis dem Zuhörer darob schwindlig wird. Wenn es hier auch mĂŒĂig ist, sie â soweit noch erinnerlich â en dĂ©tail auszubreiten, eins bleibt sicher: Wanne-Eickel schloss sich mit Herne zusammen, um nicht von Bochum verschluckt zu werden. So wie das dann Wattenscheid passierte, das glaubte, sich wie Asterix' Gallier bis zum letzten strĂ€uben zu mĂŒssen. âDa stehe ich heute noch zu, verflixt juchhe!â, sagt Manfred Urbanski, der sich gefallen lassen musste, als VerrĂ€ter beschimpft zu werden.
Doch wiedergewĂ€hlt haben sie ihn, und aus seinem Amt ist er schlieĂlich freiwillig geschieden. Aber bis heute passt manchem Wanne-Eickeler nicht in den Kram, 1975 den schönen StĂ€dtenamen verloren zu haben, den man 1926 erhielt, als sich Wanne und Eickel ihrerseits zu einer Stadt vereinten. (Was indes die Wanner wiederum nicht hinderte, im Herzen Wanner zu bleiben, und die Eickeler desgleichen.) Doch als Wanne-Eickeler Herner zu werden, ging denn doch ein bisschen zu weit. Zumal das schöne Wanner Rathaus samt Rundbogenfenster, Schweifgiebel und Zwiebelturm nun âAm Friedhofâ ein Aschenputteldasein fristen muss, wĂ€hrend das in der Herner Bebelstrasse in Amt und WĂŒrden steht. Wie aus gewöhnlich gutunterrichteten Kreisen verlautet, ist der Brauch der Wanne-Eickeler, Sozial- wie Christdemokraten, nach Erledigung der politischen GeschĂ€fte im Rat âsich tĂŒchtig einen zu pitschenâ, wie das auf ruhrdeutsch heiĂt, inkompatibel geblieben mit der seriösen SoliditĂ€t der Parteigenossen von Herne. Was Wunder, dass die âAktenfĂŒhrungâ der lustigen BrĂŒder manchem von ihnen ein GrĂ€uel war und ist.
Unangetastet geblieben ist die Macht der SPD, die hier, wie böse Zungen höhnen, konservativer sein soll als die bayrische CSU. Seit vierzig Jahren am Hebel, hat sie in den letzten Kommunalwahlen von 1994 satte 58 Prozent der Stimmen auf sich vereint; 28,8 Prozent entfielen auf die CDU, 9,3 Prozent auf die GrĂŒnen. Die FDP ist nie ĂŒber die 5-Prozent-HĂŒrde hinausgekommen, so dass eine Art informelle groĂe Koalition regiert, der die GrĂŒnen auf die Finger sehen. Aber auch diese gehören hier gewissermaĂen zur Familie, sind ihre Aktivisten doch mehrheitlich aus der SPD ausgetreten oder von den Jusos abgesprungen. Durchwegs âRealosâ, engagieren sich die GrĂŒnen in einer von der Industrie jahrzehntelang in rĂŒcksichtslosem Raubbau verseuchten Landschaft fĂŒr Sanierungs- und UmweltmaĂnahmen, fĂŒr Fahrradwege und Entwicklungsplanung.
Bei soviel Familiensinn scheint man jetzt geradezu erleichtert, dass man auch in Herne einen veritablen Skandal sein eigen nennen kann, der um so mehr zu Spekulationen reizt, als die Fakten nicht ausreichen, ĂŒberregionale Schlagzeilen zu machen. Die Stadt hat sich 1995 bei der Anmietung eines Hauses zur Unterbringung von Asylbewerbern offenkundig ĂŒber den Tisch ziehen lassen und muss nun gemĂ€ss einem dieses FrĂŒhjahr ausgehandelten Aufhebungsvertrag fast 600.000 Mark hinblĂ€ttern fĂŒr SchĂ€den, die angeblich von den Insassen verursacht worden sind. Die GrĂŒnen haben Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Bochum eingereicht, und abzuklĂ€ren bleibt, ob da jemand unter der Hand kassiert hat oder nicht.
Wi es wirtschaftlich weitergeht nach dem Ende der Monokultur, wird mit entscheidend sein fĂŒr den sozialen Frieden. Noch hat die HĂŒls-Chemie zwei Werke in Herne, doch Blaupunkt, einst freudig begrĂŒĂt, ist mittlerweile ganz nach Malaysia abgezogen. Heitkamp, ein Familienunternehmen im Baugewerbe, und die Stadtverwaltung selbst gehören zu den gröĂten Arbeitgebern der Kommune, die vierzig Prozent Auspendler zĂ€hlt und stark ĂŒberaltert ist. An den KaufhĂ€usern lĂ€sst sich ermessen, wie es um die ProsperitĂ€t bestellt ist; nach der StĂ€dtefusion hat Hertie in Wanne-Eickel dichtgemacht, und Karstadt, das seine Filialen in drei Kategorien unterteilt, fĂŒhrt eine der letzten in Herne - einer Stadt, an der der IC der Bundesbahn wie an DĂŒrrenmatts GĂŒllen ohne Halt vorbeisaust. Nur der GĂŒterbahnhof und der Hafen, gebaut zum Transport von Kohle, Stahl, Erzen und Abraum, sind bedeutend geblieben als groĂe UmschlagplĂ€tze fĂŒr StĂŒckgut.
Doch an Zuversicht will man es so wenig fehlen lassen, wie man auf das rote Rezept verzichten mag, wonach der Staat der beste Vater aller Dinge sei. Am Eickeler Markt, wo 1989 die HĂŒlsmann-Brauerei ihre Pforten schloss, weil sie die Löhne nicht mehr ausbezahlen konnte, hat die Stadt deren BetriebsgebĂ€uden neues Leben eingehaucht. Eine GaststĂ€tte im alten Sud- und Treberhaus, mit dem Braukessel als Kulisse, ist nun Treffpunkt der lokalen Kulturszene; die dazupassende stĂ€dtische Wohnsiedlung nebenan, eben erstellt, verleugnet trotz coolem Outfit die Abkunft von den heimischen Zechenkolonien nicht.
Mit einem halben Dutzend StĂ€dtepartnerschaften in Mittel- und Osteuropa sowie in Zentralamerika entschĂ€digt sich Herne fĂŒr das Schicksal, als Teil des Ruhrgebietes fĂŒr die Regierungen jedweder Couleur immer nur den Kumpel gespielt zu haben. Bis Mitte der sechziger Jahre gab es im Kohlenpott keine UniversitĂ€t; wer da lebte, hatte zu malochen, und damit basta. HĂ©nin-Beaumont in Frankreich, Wakefield in England, die Insel Ometepe im Nicaraguasee, Eisleben in der Ex-DDR, Konin in Polen und Belgorod in Russland: Das sind die Kumpels, mit denen man via Sportvereine und Chorgemeinschaften, Schulklassen und Jugendorganisationen, Musikgruppen, KĂŒnstler- und WirtschaftsverbĂ€nde freundnachbarlichen Kontakt pflegt. Und dass etwa aus dem fernen Belgorod meist doppelt so viele angereist kommen wie angemeldet, lĂ€sst man so gelassen ĂŒber sich ergehen wie die Festfreude der Russen, die selbst da noch durchhalten, wo sogar ein gestandener Wanne-Eickeler schlappzumachen droht.
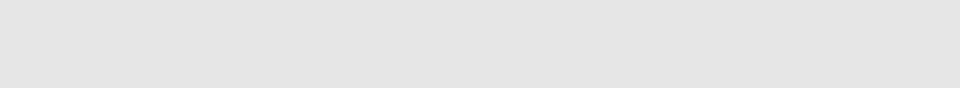
powered by:

|
|
||
|
|

